2. Welche Rechtsform ist die richtige?
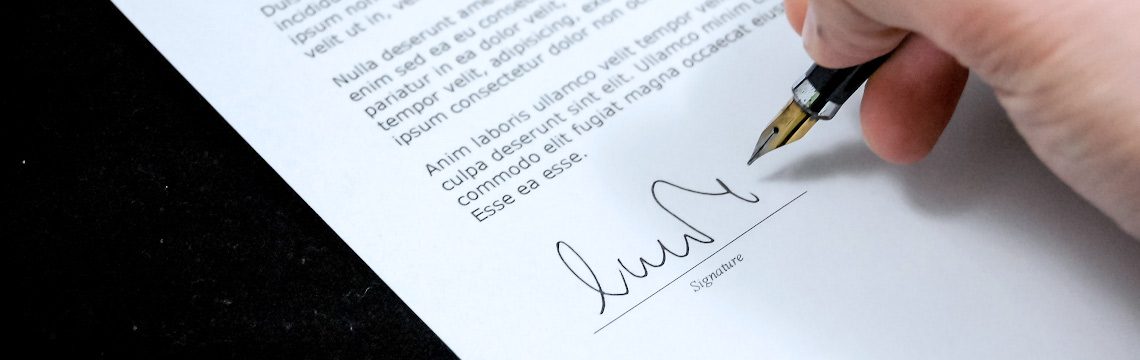
Wenn du ein Unternehmen gründen willst, musst du dich irgendwann für eine Rechtsform entscheiden. Die Rechtsform bestimmt u. a.:
- ob du mit deinem Privatvermögen haftest,
- wie viel Startkapital nötig ist,
- wie viel Bürokratie und Pflichten auf dich zukommen.
Die Entscheidung für eine Rechtsform ist gar nicht immer so leicht, denn es gibt eine große Auswahl. Deshalb holen sich Gründer:innen oft Rat bei Rechtsanwält:innen oder Steuerberater:innen. Aber Achtung: Fragst du zwei Expert:innen, bekommst du oft drei Meinungen. Denn die eine perfekte Rechtsform gibt es nicht – jede hat ihre Vor- und Nachteile.
Bei der großen Anzahl an möglichen Rechtsformen unterscheidet man grob zwischen Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften.
Personengesellschaften
- Einzelunternehmen: Die einfachste Form. Du entscheidest alles selbst, brauchst kein Startkapital, haftest aber komplett mit deinem Privatvermögen.
- GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts): Zwei oder mehr Personen schließen sich zusammen. Kein Mindestkapital, aber alle haften voll mit ihrem Privatvermögen.
- oHG (Offene Handelsgesellschaft): Ähnlich wie die GbR, aber größer und ins Handelsregister eingetragen. Alle haften unbegrenzt.
- KG (Kommanditgesellschaft): Mischung: Mindestens ein Gesellschafter haftet voll (Komplementär), andere nur bis zu ihrer Einlage (Kommanditisten).
Personengesellschaften zeichnet aus, dass immer mindestens eine Person komplett mit dem Privatvermögen haftet.
Kapitalgesellschaften
- GmbH: Haftungsbeschränkt, d. h. dein Privatvermögen bleibt sicher. Du brauchst aber mindestens 25.000 € Startkapital.
- UG (haftungsbeschränkt): „Mini-GmbH“. Start schon ab 1 €, aber du musst Gewinne ansparen, bis du 25.000 € erreicht hast.
- AG (Aktiengesellschaft): Aufwendig, Mindestkapital 50.000 €. Eher für sehr große Unternehmen.
- Genossenschaft (eG): Mindestens drei Mitglieder, Entscheidungen demokratisch. Praktisch für gemeinschaftliche Projekte (z. B. Bau- oder Schülergenossenschaften).
- Verein (e.V.): Ab sieben Mitgliedern möglich, gut für gemeinnützige Zwecke.
- gGmbH / gUG: Wie GmbH oder UG, nur mit Fokus auf Gemeinnützigkeit. Steuerlich begünstigt.
Bei Kapitalgesellschaften ist die Haftung auf das Vermögen des Unternehmens begrenzt. Also, in Sachen Haftung ein klarer Vorteil gegenüber Personengesellschaften!
Was heißt eigentlich „Kaufmann“?
Ab einer bestimmten Unternehmensgröße (z. B. viele Kunden, hohe Umsätze, Angestellte) giltst du automatisch als Kaufmann. Dann musst du dich ins Handelsregister eintragen und strengere Regeln beachten. Tipp: Wenn du klein startest, betrifft dich das erstmal nicht.
Video: Qual der Wahl - Welche Rechtsform ist die richtige?
👉 Fazit:
Für den Anfang empfehlen sich die formell einfachen Rechtsformen, wie Einzelunternehmen oder GbR. Wer mehr Sicherheit in Haftungsfragen haben will, sollte eine UG gründen. Die gibt es auch als gemeinnützige UG (gUG).
